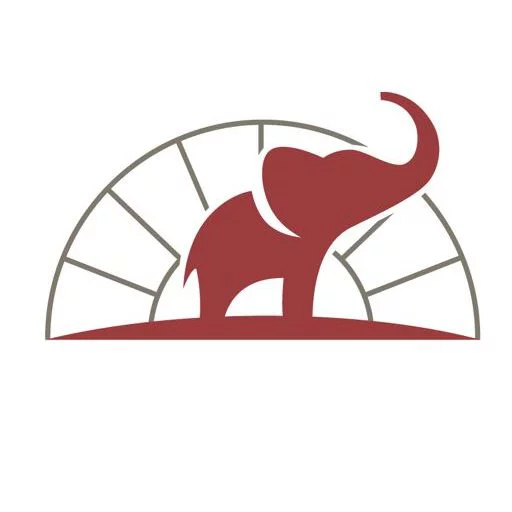Apothekerin Hildegard Rose & Apotheker Paul Gustav Rose

Nach dem Tode von Karl Laureck präsentierte sich seine Tochter Hildegard Rose, geb. Laureck als Nachfolgerin, da sie wegen des Realrechtes, auf dem die Apotheke begründet war, und wegen der vom Vater erlassenen letztwilligen Verfügung als Nachfolgerin dazu berechtigt war. In Eile mußte eine Ersatzurkunde der Approbation besorgt werden, weil das Original durch Kriegseinwirkung verloren gegangen war. Die Konzession wurde ihr erteilt, so dass sie die Apothekenleiterin war. Ihr Mann fungierte als Mitarbeiter. Hildegard Rose wurde am 29.8.1905 in Burgsteinfurt geboren. Von Ostern 1911 bis Ostern 1920 besuchte sie die höhere Mädchenschule in Burgsteinfurt und anschließend die Studienanstalt der Ursulinen in Osnabrück. Dort bestand sie 1925 die Reifeprüfung. Am 1.4.1925 trat sie in ihrer väterlichen Apotheke die Lehre an. Die pharmazeutische Vorprüfung bestand sie am 11.3.1927 in Münster mit der Note „sehr gut“. Bis zum Beginn des Studiums am 16.4.1928 blieb sie in der väterlichen Apotheke. Nach zwei Semestern Studium in Freiburg (Breisgau) und zwei Semestern in Bonn bestand sie dort das pharmazeutische Staatsexamen am 23.5. 1930 mit „sehr gut“. Im Jahre 1930 arbeitete sie in der väterlichen Apotheke, 1931 in der Roland-Apotheke in Köln, dann bis 1933 in der Adler-Apotheke in Langenberg (Rhld.). Während des zweiten Weltkrieges half sie ihrem Vater in Burgsteinfurt.
Paul Gustav Rose wurde am 9.Mai 1907 in Posen geboren als zweiter Sohn des Kreisobersekretärs Max Rose und seiner Frau Therese, geb. Schmidt. Er besuchte das Realgymnasium in Angermünde und bestand die Reifeprüfung am 21.März 1925. Nach zweijähriger Lehrzeit in der Rats-Apotheke in Angermünde bestand er am 16.März 1927 die pharmazeutische Vorprüfung. Er studierte an der Universität Bonn, wo er auch seine Lebensgefährtin kennenlernte. Vertretungen in Vierraden (Kreis Angermünde), Müllrose i.M., Oderburg i.M., Schwedt a.d. Oder, Granzow i.M. und in seiner Lehrapotheke in Angermünde während der Studienzeit erweiterten seinen beruflichen Erfahrungsbereich. Am 23. Mai 1930 bestand er sein pharmazeutisches Staatsexamen mit „gut“. Anschließend arbeitete er in Königswinter (Rhld.), Stolberg (Rhld.), Aschaffenburg (Main), und in Kassel. Am 28. Oktober 1933 heiratete er in Kassel seine Kommilitonin Hildegard Laureck aus Burgsteinfurt. Am 1.1.1937 trat er in die schwiegerväterliche Apotheke ein. Er wurde am 9.4.1938 in Burgsteinfurt vereidigt. Der Amtseld liegt uns vor, er soll wegen des damals gültigen und gegenüber der alten Eidesformel geänderten Wortlautes hier zitiert werden:
„Burgsteinfurt, den 9.4.1938. Verhandlung über die Vereidigung des Apothekers Paul Gustav Rose, Burgsteinfurt. Es erscheint der Apotheker Paul Gustav Rose aus Burgsteinfurt zum Zwecke der Vereidigung auf seine Berufspflichten. Die Approbation, ausgestellt vom 11.4.32 wurde vorgelegt. Hierauf leistete Herr Paul Gustav Rose gemäß Erlaß des Ministeriums vom 18.7.1840 (M.Bl. S.309) folgenden Eid: „Ich, Paul Gustav Rose, schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, dass ich, nachdem mir die Approbation zum selbständigen Betrieb einer Apotheke im Gebiete des deutschen Reiches erteilt worden ist, dem Führer und Reichskanzler des deutschen Volkes Adolf Hitler Gehorsam leisten werde und alle mir vermöge meines Berufes obliegenden Pflichten nach den darüber bestehenden oder noch ergebenden Verordnungen nach meinem besten Gewissen erfüllen will, so wahr mir Gott helfe“. Paul Gustav Rose, Apotheker. Gez. der Landrat.“
Er wurde im August 1939 als Heeresapotheker eingezogen. Erst nach Kriegsende konnte er seinem Schwiegervater wieder zur Hand gehen. Die Auslagerung der Reste der Apothekeneinrichtung und die Wiederaufnahme des Apothekenbetriebes auf der Wasserstraße 21 (heute Wasserstraße 24) war nur ein Provisorium, zu dem Apotheker Laureck durch die Stadtverwaltung genötigt worden war. Erst seine Tochter Hildegard und sein Schwiegersohn Paul Gustav Rose konnten nach der Währungsreform mit dem Wiederaufbau der zerstörten Apotheke beginnen. (Im Hause Wasserstraße 24 wurde 1952 die zweite Apotheke von Burgsteinfurt, die Stadt-Apotheke eingerichtet, die von Walter Rose am 1.1.1996 gekauft, in Altstadt-Apotheke unbemannt und noch dreieinhalb Jahre geleitet wurde).
Seit dem Kriegsende mangelte es an allem, vor allem an den lebensnotwendigen Arzneimitteln. So mußten die Apotheker alle nur denkbaren Wege nutzen, um die Bevölkerung zu versorgen. Paul Gustav Rose schwang sich daher eines Tages auf sein Fahrrad und fuhr bis ins Ruhrgebiet, um nach Vorräten zu suchen. Seine Fahrradbenutzungsgenehmigung in englischer Sprache lautete:
13 May 45. Possession Certificate
This is to certify that the Bearer of this Certificate, Identity Cart No.A00995 is permitted to be in possession of a B I C Y C L E and to ride same between the hours of 0600 hrs and 2400 hrs.
1st Bn The Manchester Regt.
Der Mangel an Baumaterial war natürlich für die ausgebombten Familien ein schier unüberwindbares Problem, da die wenigen Materialien streng nach Bedürftigkeit zugeteilt werden sollten.
Hinzu kamen die vom Staat im Übermaß eingeführten Steuern:
Eine Soforthilfeabgabe, die auf das Apothekenrecht entfiel; der Lastenausgleich, der den Vertriebenen zur Hilfe kommen sollte; das Notopfer Berlin, das der eingekesselten Stadt helfen sollte; die Investitionshilfe, die wie eine Anleihe konzipiert war, die aber praktisch eine Zwangsanleihe war.
Dass Bürger, die durch Vernichtung ihres Eigentums durch Bombardierung praktisch vor dem Nichts standen, auch zu diesen Abgaben herangezogen wurden, behinderte den Wiederaufbau stark.
Aber da sie ja keine Ersparnisse hatten, fiel wenigstens nicht die Kreditgewinnabgabe an, die ebenfalls damals eingeführt wurde und zu unserer Zeit als Quellensteuer weiterlebt. Auch die Vermögenssteuer, die z.B. auch auf den Wert eines Apothekenrechtes erhoben wurde, behinderte die Investitionsmöglichkeiten. Immerhin wurde die Entwertung der Realrechte durch die Auswirkungen der Niederlassungsfreiheit in der amerikanischen Zone für die englische und die französische Zone auf 50 bis 60 Prozent geschätzt, während in der amerikanischen Zone ein Wert entfiel. Bei einem Umsatz von 210.000,- bis 254.000,-Mark in den Jahren 1949 bis 1952 und einem Gewinn von ca. 44.000,-M war es schon ein mutiger Entschluß, hohe Kredite zur Finanzierung des Neubaues aufzunehmen. Dazu mußte ein gutes Nutzungskonzept entworfen werden. Die Apotheke sollte nicht die ganze verfügbare Front des neuen Hauses einnehmen, sondern sich den Platz mit dem Uhren- und Juweliergeschäft Oberkötter teilen. Über einen Kredit der Firma Oberkötter, der über die Miete abgezahlt wurde, konnte ein Teil des nötigen Geldes beschafft werden. Ein Kredit der öffentlichen Hand für die Einrichtung von Wohnraum für Flüchtlinge brachte auch etwas Geld. Ein Kredit über eine Lebensversicherung half weiter. Da für die Wohnung und die Apotheke keine Miete mehr gezahlt werden mußte, gab es einige Ersparnisse in der Lebensführung. Die Jahre nach dem Aufbau waren gekennzeichnet von ständigen Geldsorgen, die sich in vielen Steuerstundungsanträgen niederschlugen. Auch die Schuld aus der Erbschaft, die in der Auszahlung der beiden Schwestern von Hildegard Rose bestand, mußte nach zwei Jahren Zahlung angehalten werden und konnte erst später getilgt werden.
Wie absurd das Finanzamt Steuern erhob, beleuchtet die Tatsache, dass das Abräumen von Schutt auf zerbombten Grundstücken für private Haushalte abzugsfähig war, für Betriebe aber nicht. Der erlittene Kriegsschaden wurde dem Finanzamt bei einem Stundungsantrag für die zu zahlende Investitionshilfe so beziffert:
a) Gebäudeschaden (nach den Wiederaufbaukosten berechnet)
90.000,
40.000,
30.000,
b) Schäden an der Betriebseinrichtung
c) Schäden an Hausrat und Bekleidung
Bisheriger Aufwand zur Schadensbeseitigung:
a) Wiederaufbau des Hauses (teilweise) 90.000,
b) teilweise Einrichtung neu 15.000,
alles aus hochverzinslichen Fremdmitteln, und das mit der Erbauseinandersetzung in
Höhe von 5% vom Umsatz für 10 Jahre im Nacken, was ca. 10.000,- pro Jahr bedeutete. Das beim Tode von Karl Laureck vorhandene Vermögen wurde auf 146.000,- beziffert, wobei auf das Apothekenrecht (ein Betrag, der nur fiktiv war) 59.000,- entfielen, real also 87.000,- in Grundstück, Betriebsvermögen, Sparguthaben und Wertpapieren vorhanden waren. Dies gab den Ausschlag für die Annahme des Testamentes, aber auch das Pflichtbewußtsein der Tochter gegenüber dem Vater, die Apotheke zu erhalten.
Nach der Währungsreform waren diese Guthaben um 67.800,- gesunken, so dass saldiert der Rest des Vermögens auf 23.000,- und ein Verlust von 64.000,- festzustellen war, ohne den Wert des Realrechtes. So mußten die Eheleute Rose nach zwei Jahren Erbschaftszahlungen um eine Aussetzung bitten, um ihre sonstigen Verpflichtungen begleichen zu können. Die Söhne können sich noch an eine Diskussion zwischen den Eltern erinnern, wo sie besprachen, ob sie ihrer Angestellten Frau Döhrmann eine spätere Zahlung des fälligen Gehaltes zumuten könnten, und ob sie sie um Stundung bitten könnten. Letztendlich ist nach einer Feststellung des Steuerberaters nicht den Eheleuten Rose, sondern den Schwestern von Frau Rose der überwiegende Teil des Vermögens zugefallen.
Ein Schreiben des Finanzamtes vom 13. November 1953 konnten die Eheleute Rose nur noch als blanken Hohn empfinden: „kann ihre wirtschaftliche Lage nicht als so ernst angesehen werden, daß Ihnen die Zahlung der rückständigen Raten der Investitionsabgabe nicht zugemutet werden könnte. Die Umsätze sind um 10 v.H. angestiegen. Es dürfte ausserdem sehr zweifelhaft sein, ob Sie in den Monaten Januar bzw. Februar 1954 eher in der Lage sein werden, die rückständigen Raten zu zahlen, wobei noch zu bedenken ist, daß ein Erlaß für Sie nicht in Frage kommt.“
Eine Besonderheit des Steuerrechts verwehrte es bis 1956, den Ehemann der Apothekenbesitzerin als Angestellten zu führen. Bis dahin wurden sie als gemeinsame Eigentümer geführt, das heißt, dass das Gehalt des Ehemannes nicht als Betriebskosten abzugsfähig war, obwohl nur die Ehefrau Apothekenbesitzerin war. Noch 1960 mußten sich die Eheleute mit dem Finanzamt um den Status des Ehemannes im Betrieb streiten, trotz BFH-Urteils vom 28.1.1958!
Am 11.9.1948 wurde der Grundstein zum Wiederaufbau der Elefanten-Apotheke gelegt. Die Grundsteinurkunde lautete :
„Heute, am 78. Jahrestag der Geburt meines Vaters, des Apothekers Karl Laureck, der die Apotheke bis zu seinem Tode am 3.9.1947 geführt hat, legen wir den Grundstein zum Wiederaufbau der ältesten Burgsteinfurter Apotheke.
(Es folgt ein Abriss der Apothekengeschichte).
Bevor mein Vater nach langem Leiden am 3.9.1947 starb, übergab er mir und seinen anderen Mitarbeitern den Auftrag, die Apotheke sobald wie möglich wieder aufzubauen. In seinem Sinne legen wir heute an seinem Geburtstag den Grundstein zu neuem Anfang.“
Im Jahre 1949 wurde die Apotheke von der Wasserstraße wieder zur Steinstraße zurückverlegt.
Durch die alte Apothekentür gehend fand man zur Rechten den Eingang zur Apotheke, zur Linken den Eingang zum Uhren- und Schmuckgeschäft Oberkötter. Im hinteren Teil des Erdgeschosses waren die Wohnräume der Familie Rose, im Keller die Küche, die durch einen selbstgebauten sinnvoll funktionierenden Drahtseilaufzug das Essen ins Erdgeschoß schicken konnte.
Die Eröffnung der zweiten Apotheke in Burgsteinfurt im Jahre 1952 unter dem Namen Stadt-Apotheke konnte die gute Entwicklung der Elefanten-Apotheke nicht aufhalten. Zwar bemühten sich die Pächter (der Eigentümer war nur Inhaber der Konzession, hatte die Apotheke aber gleich verpachtet), zunächst Apotheker Sauberzweig, dann Apotheker Seveke, der eine Reformabteilung angliederte, dann Apotheker Dr. Kauder und schließlich Frau Apothekerin Horst, später verheiratete Koch um einen Teil des Gesundheitsmarktes, konnten jedoch in kollegialem Konkurrenzkampfnur eine Nische besetzen.
So bauten die Eheleute nach kurzem eine Hälfte des Obergeschosses auf, damit die Wohnräume aus dem Erdgeschoß in das erste Stockwerk gelegt werden konnten. Auch die Approbierte Frau Margarethe Döhrmann erhielt dort ein Zimmer. Die Wohnsituation war aber weiter sehr beengt, so daß die Hausgehilfinnen im Erdgeschoß wohnen blieben und die beiden älteren Söhne schließlich wieder ins Erdgeschoß ins Büro zogen, damit sich die vier Söhne bei den Schulaufgaben nicht zu sehr störten. Denn das Schmuckgeschäft Oberkötter war zwischenzeitlich ausgezogen, und die danach eingezogene Barmer Ersatzkasse hatte ebenfalls größere Räume in Burgsteinfurt gefunden, so dass das Apothekenbüro in diesen Raum verlegt wurde. Schließlich, nachdem die beiden älteren Söhne im Studium waren und die Apotheke eine größere Offizin benötigte, wurde 1961 in einem großen Umbau eine sehr große, lichte und fortschrittliche Offizin eingerichtet. Dieser Umbau war eine gewaltige Kraftanstrengung für das Ehepaar Rose. Die beiden Söhne kamen aus dem Studium um zu helfen. Aber nur ein Jahr konnten sie sich an den guten Arbeitsbedingungen freuen, dann kam die nächste Konkurrenz, die Anker-Apotheke eröffnete im November 1962. Sie legte sich zwischen fast alle Ärzte und direkt an den Wochenmarkt und hatte damit und mit ihrer Geschäftsphilosophie, die dem Ehepaar Rose und ihren Mitarbeitern völlig unbekannt war, erhebliche Umsatzeinbrüche bei der Elefanten-Apotheke erreicht. Die schon überwunden geglaubten Geldsorgen kamen verstärkt zurück, zumal mittlerweile drei Söhne auswärtig im Studium waren. So schränkten sich die Eheleute soweit wie möglich ein, bis sie schließlich 1967 durch die Beendigung der Tätigkeit ihrer Approbierten Frau Döhrmann zu neuen Entscheidungen gezwungen wurden. Nach eingehenden Überlegungen wurde eine neue große Planung aufgestellt und durchgeführt:
Die Apothekenleitung übernahm der Sohn Walter Rose als Pächter. Der letzte Bauabschnitt des Aufbaues des Apothekengebäudes wurde durchgeführt und Herr Dr. med. Reinhard Hagemann richtete eine internistische Praxis im Obergeschoß ein. Das Ehepaar Hildegard und Paul Gustav Rose zog in das Dachgeschoß, die junge Familie Walter Rose in das Obergeschoß neben die Praxis Dr. Hagemann. Neben den qualifizierten Mitarbeitern legten die Apothekenleiter großen Wert auf die Ausbildung von Nachwuchs für den Beruf. Das Ehepaar Rose bildete neun Helferinnen, zehn Apothekerpraktikanten/-innen und fünf Kandidaten/-innen der Pharmazie aus. Viele ehemalige Auszubildende hielten auch nach dem Abgang aus der Lehrapotheke den Kontakt zu Hildegard Rose aufrecht und besuchten sie immer, wenn sich die Gelegenheit dazu ergab.

Der briefliche Kontakt wurde oft und lange gepflegt. Das Ehepaar Paul Gustav und Hildegard Rose erlebte nun weniger sorgenvolle Jahre als zu ihrer aktiven Apothekenleiterzeit. Paul Gustav Rose hatte zeitlebens viele Neigungen, denen er mit Begeisterung und viel Einsatz nachging. Er ist bis zum Lebensende seiner Studentenkorporation, der Turnerschaft Teutonia Bonn sowie dem VaCC treu geblieben. Er baute nach dem Krieg für die Vertriebenen die Landsmannschaft der Pommern auf und übernahm den Vorsitz bei den Pommern, West- und Ostpreußen; sein Einsatz für das Sozialwerk der Pommern sowie den Paketversand nach Pommern war unermüdlich. Sein Anliegen war es, für die Landsmannschaften im Heimatmuseum eine ostdeutsche Stube einzurichten, um dort eine Präsentation der verlorenen Heimat und des ostdeutschen Brauchtums zu schaffen. Ein weiterer Schwerpunkt, aus der Freude am Turnen geboren, war seine Mitgliedschaft im Turnerbund, wo er als Wanderwart und in der Fahnenabteilung zur Verfügung stand. Sein Einsatz wurde mit der goldenen Ehrennadel des Turnerbundes, der Ehrennadel des Münsterländer Turngaues und der Frau zum Weltmeister im Wildwasserabfahrtslauf der gemischten Kanadier. Im Kneipp-Verein hatte er den stellvertretenden Vorsitz inne, beim Heimat- und Verkehrsverein war er Kassenprüfer. Eine besondere Freude bereitete ihm das plattdeutsche Klönen, wo er das pommersche Platt einbrachte. Bei den Verschrtensportlern beaufsichtigte er das Verschrtenschwimmen. Mit großer Freude besuchte er die Tanzveranstaltungen in Burgsteinfurt, die Karnevalsbälle sahen ihn immer in ausgefallenen Verkleidungen. Für den Apothekerstand war er tätig als Mitglied der Kammerversammlung von 1939 bis 1945 und wurde nach dem Krieg wieder dafür vorgeschlagen, mußte aber wegen Arbeitsüberlastung ablehnen. Als Mitglied der Pharmazeutischen Gesellschaft und der Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie förderte er Einrichtungen des Apothekerstandes. Für viele verblüffend war seine profunde Kenntnis in der Geschichte, seine außerordentliche Allgemeinbildung erweiterte er durch genaue und gründliche Besuche von Ausstellungen. Dort konnte er stundenlang zubringen und sich an immer neuen Aspekten freuen.
Paul Gustav Rose starb am 31.1.1985 plötzlich und unerwartet. Hildegard Rose starb am 28.4.1992 nach langer schwerer Krankheit.
Ein Verbandsbruder von Paul Gustav Rose, der als Student begeisterter Turnerschafter war, schrieb augenzwinkernd seinem Freund ins Stammbuch:
„Gott schütze Dich Dein Leben lang,-
doch werde bitte auch mal krank!“
Diesen gutgemeinten Rat
las ich neulich in der Tat
an eines Apothekers Klause-
nicht am wohlgebauten Hause
eines Manns der Medizinen
(etwas muß auch der verdienen!).
Als Philologe, der ich bin,
kam sogleich mir in den Sinn:
Was bedeutet Apotheke?
Natürlich kommt’s-man wird es wissen-
wie vieles aus dem Griechischen:
„Behälter“ heißt es oder „Speicher“.
Und um die Erkenntnis reicher
kam mir die Frage in den Sinn:
Was ist wohl in dem „Speicher“ drin?
Sicher viele Pharmaka,
Pillen, Kapseln, Venena!
Doch was sagt die böse Welt?
„Auch dieses, doch vor allem Geld!“
Dies ist, so sag ich tief empört,
Verleumdung! Lüge! unerhört!
Trotz den schlimmen Ignoranten!!!-
Mag im Haus des Elefanten
weiter stets die Kasse klingen
beim Verkauf von vielen Dingen,
die eines Menschen schwacher Korpus
mitunter leider schlucken muß!
(Hans Wedemeyer)
Das Ehepaar Rose hatte ein erfülltes Leben mit vielen Höhen und Tiefen geführt, angefangen mit dem ersten Weltkrieg und der Hungerzeit in ihrer Kindheit über die Wirren der Weimarer Zeit, die totale Einflußnahme der Hitlerdiktatur bis zum Zusammenbruch am Ende des Krieges. Dann schafften sie den Aufbau der zerstörten Apotheke und erlebten die Konsolidierung der wirtschaftlichen Verhältnisse.
Ihr Vorgänger Karl Laureck, der Vater von Hildegard Rose, war dagegen die tragischste Person in der Apothekengeschichte. Er hatte mit beispiellosem Einsatz die Apotheke in die Neuzeit geführt und stand am Ende seines Lebens vor den Trümmern seines Lebenswerkes nach einem sinnlosen Krieg.